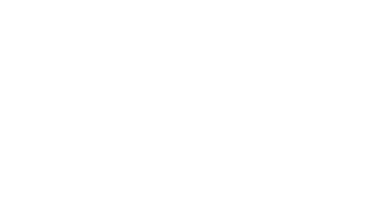ZUGEWINN UND VERMÖGENSRECHT
Geht es um die Aufteilung des gemeinsamen Vermögens, um die Regulierung gemeinsamer Schulden, um die Nutzung des Familienheims oder eine Nutzungsentschädigung? Haben Sie Fragen zur Rückforderung von Schenkungen oder anderen Zuwendungen, ob nun durch den Ehegatten oder Schwiegereltern?
Gern stehen wir Ihnen zur Verfügung; vereinbaren Sie ein Beratunggespräch.
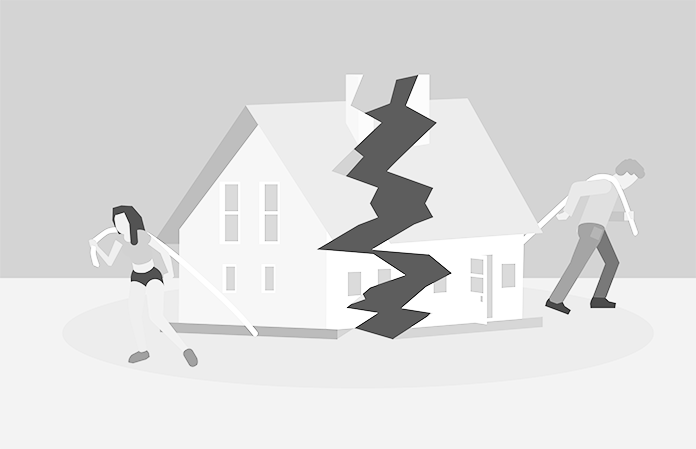
13053 Berlin, Orankestr.1
030/982 43 13
mail@ra-wiedner.de
EINIGE INFORMATIONEN
Zugewinnausgleich
Sofern in einem Ehevertrag nicht etwas anderes vereinbart wurde, leben die Ehegatten im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Bei der Zugewinngemeinschaft bleiben die Vermögen der Eheleute getrennt, jeder Ehegatte bleibt Alleineigentümer seiner Vermögensgegenstände.
Zum Ausgleich kommt im Rahmen der Ehescheidung der Zugewinn, d.h. der Vermögenszuwachs während der Ehezeit, nicht jedoch das Vermögen der Eheleute, welches die Eheleute vor der Ehe bereits hatten oder Vermögen welches während der Ehe durch Schenkung oder Erbschaft erlangt wurde.
Zugewinn ist dann der Betrag, um den das Endvermögen des Ehegatten sein Anfangsvermögen übersteigt.
Vermögen welches während der Ehezeit durch Schenkung oder Erbschaft erworben wurde, ist dem Anfangsvermögen mit dem Wert zum Zeitpunkt des Vermögenserwerbs und dem Endvermögen mit dem Wert zum Scheidungszeitpunkt hinzuzurechnen, so dass Wertsteigerungen im Rahmen des Zugewinnausgleichs zum Tragen kommen können, im Übrigen diese Vermögenswerte neutral bleiben.
Da im Rahmen des Zugewinns jedoch nur reale Wertsteigerungen Berücksichtigung finden sollen, ist darüber hinaus, das Anfangsvermögen noch zu indexieren, d.h. bei der Wertermittlung findet der inflationsbedingte Kaufkraftschwund Beachtung.
Diese Berechnung ist für beide Ehegatten vorzunehmen und die jeweiligen Zugewinnbeträge zu vergleichen. Übersteigt sodann der Zugewinn des einen Ehegatten den des anderen, so hat der Ehegatte mit dem geringeren Zugewinn einen Ausgleichsanspruch auf Zahlung des hälftigen Überschusses, den Zugewinnausgleichsanspruch.
Am 01.09.2009 ist das Gesetz zur Änderung des Zugewinnausgleichs- und Vormundschaftsrechts in Kraft getreten. Mit dieser Änderung wird nunmehr ein negatives Anfangs- und Endvermögen eingeführt, d.h. die Tilgung von Schulden eines Ehegatten während der Ehezeit, die dieser vor der Ehe eingegangen ist, wird in den Zugewinn eingerechnet.
Neben dem Auskunftsanspruch über das Vermögen zum Stichtag (Zustellung des Ehescheidungsantrages an den anderen Ehegatten) = Endvermögen, ist nunmehr auch ein Auskunftsanspruch auf den Tag der Trennung (§ 1379 I S. 1 Nr. 1 BGB) über das Vermögen gegeben.
Das bedeutet allerdings, dass beide Eheleute übereinstimmend den TAG der Trennung benennen. Ist der Trennungszeitpunkt streitig oder nicht genau bestimmbar, ist eine Auskunft auf den TRENNUNGSTAG nicht möglich. Auf Anforderung sind Belege (Kontoauszüge, Verträge, Bankbestätigungen u.ä.) vorzulegen. Damit soll der illoyalen Vermögensminderung nach der Trennung entgegen getreten werden.
Eine arbeitsrechtliche Abfindung zählt dann zum Endvermögen, wenn sie vor dem Stichtag (Ende der Ehezeit) verbindlich zugesagt war und bei Rechtshängigkeit des Ehescheidungsantrages noch vorhanden ist. Sollte allerdings die Abfindung bereits beim Unterhalt als Einkommen berücksichtigt sein, gehört sie nicht mehr zum Endvermögen. Eine Doppelverwertung im Unterhalt und im Zugewinn findet nicht statt.
Kapitallebensversicherungen sind nur dann mit dem Rückkaufswert anzusetzen, wenn am Stichtag mit der Fortführung des Versicherungsvertrages nicht zu rechnen ist. Wird der Versicherungsvertrag fortgesetzt ist ein nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten bemessender Zeitwert anzusetzen.
Für Wertpapiere ist der mittlere Tageskurs an der nächstgelegenen Börse maßgeblich.
Der Zugewinnausgleich unterliegt nicht der Schenkungssteuer.
Die Ausgleichsforderung verjährt regelmäßig in drei Jahren ab positiver Kenntnis des Ausgleichsberechtigten von der Beendigung des Güterstandes.
Gesamtschuldnerausgleich zwischen Ehegatten
Die Rückzahlung ehebedingter Schulden, die Geschäfte zur Deckung des Lebensbedarfs betreffen, haben beide Eheleute gemeinsam kraft Gesetzes zu tragen (§ 1357 BGB).
Bei Krediten, die beide gemeinsam eingegangen sind, haften ebenfalls beide Eheleute gemeinsam gegenüber dem Kreditgeber.
Auch für Steuerschulden aus gemeinsamer Veranlagung haften beide gesamtschuldnerisch.
Bei einer intakten Alleinverdienerehe ist ein Gesamtschuldnerausgleich ausgeschlossen.
Nach dem Scheitern der Ehe ist das Gegenseitigkeitsverhältnis aufgehoben. Mit der Trennung lebt der aus § 426 BGB resultierende Ausgleichsanspruch auf, ohne dass dafür eine besondere Erklärung des bisher die Schuld allein abtragenden Ehegatten erforderlich wäre. Danach haften die getrennt lebenden Eheleute einander im Innenverhältnis jeweils zur Hälfte, sofern nichts anderes zwischen ihnen vereinbart ist.
Maßgeblicher Stichtag ist der Tag der Zustellung des Ehescheidungsantrages an den anderen Partner (OLG München FamRZ 2000, 672).
Der Gesamtschuldnerausgleich ist im Unterhaltsverfahren zum Ehegattenunterhalt zu beachten. So hat der Unterhaltsschuldner keinen Anspruch auf Gesamtschuldnerausgleich, wenn die Gesamtschuld bei der Unterhaltsberechnung auf Seiten des Unterhaltsschuldners vollständig berücksichtigt wird. Hierdurch vermindert sich der Unterhaltsanspruch und der Unterhaltsberechtigte beteiligt sich über die Unterhaltskürzung an der Tilgung der gemeinsamen Schulden. Damit liegt eine anderweitige Bestimmung i.S. des § 426 Abs. 1 Satz 1 BGB vor, die keinen weiteren Ausgleich mehr zulässt.
Nutzungsentschädigung
Während der Dauer des Getrenntlebens hat der freiwillig aus dem zu Miteigentum gehörenden Grundstück/Wohnung ausgezogene Ehegatte gegen den auf dem Grundstück/in der Wohnung Verbleibenden einen Anspruch auf Nutzungsentschädigung. Der Vergütungsanspruch entsteht unmittelbar durch Geltendmachung eines Zahlungsanspruches und wirkt nur für die Zukunft.
Die Höhe der Nutzungsentschädigung richtet sich nach Billigkeitserwägungen (§ 1361 b Abs. 3 BGB). Trägt der in der Wohnung oder im Haus verbleibende Ehegatte die gesamten Hauslasten (verbrauchsunabhängige Kosten, Darlehensraten mit Zins und Tilgung) allein, mindert dies die Nutzungsentschädigung oder lässt sie ganz entfallen.
Im Ehegattenunterhalt gilt: Ist der eine Ehegatte dem anderen unterhaltsverpflichtet, ist die alleinige Nutzung des Eigenheims als vermögenswerter Vorteil (Wohnwert) bei der Unterhaltsberechnung als Einkommen zu berücksichtigen. Eine zu zahlende Nutzungsentschädigung mindert wiederum diesen Vorteil.
Zuwendungen der Schwiegereltern an das Schwiegerkind
Die Zuwendungen der Schwiegereltern an das Schwiegerkind, die um der Ehe des Kindes willen gemacht werden, werden als echte Schenkung i.S. des § 516 BGB angesehen.
Der XII. Zivilsenat des BGH hat mit seiner Entscheidung vom 20.07.2011 (XII ZR 149/09 FamRZ 2012, 273) die Zuwendungen von Schwiegereltern an das Schwiegerkind nunmehr als Schenkung qualifiziert und in Anwendung der Grundsätze des Wegfalls der Geschäftsgrundlage, ggf. auch nach Bereicherungsrecht, dem Rückausgleich unterworfen, wenn die Ehe des Kindes mit dem Schwiegerkind scheitert.
Der Grundsatz des Wegfalls der Geschäftsgrundlage wird auch nicht durch die Vorschriften des Zugewinnausgleiches verdrängt.
Der Rückforderungsanspruch entsteht erst mit dem Scheitern der Ehe (Trennungszeitpunkt) Zustellung des Ehescheidungsantrages an den anderen Partner). Dann steht auch erst fest, dass und in welcher Höhe der Rückforderungsanspruch entstanden ist.
Bei der Bestimmung des Rückforderungsanspruches ist zu prüfen, inwieweit die Geschäftsgrundlage entfallen ist. Solange das eigene Kind von der Schenkung profitiert, ist dies Geschäftsgrundlage nicht vollständig entfallen, ein 100%iger Rückausgleich ist die Ausnahme und ist eventuell bei einer kurzen Ehedauer gegeben. Außerdem ist der Umgang der beim Schwiegerkind noch tatsächlich vorhandenen Vermögensmehrung zu berücksichtigen. Auch eingetretene Wertverluste sind zu berücksichtigen.
Die Obergrenze des Anspruchs der Schwiegereltern ist der Betrag, um den das Vermögen des Schwiegerkindes bei Trennung noch vermehrt war (BGH XII ZR 316/02, FamRZ 2006, 394, 395).